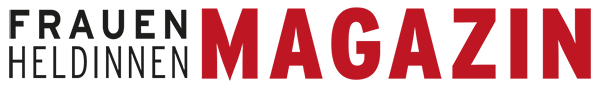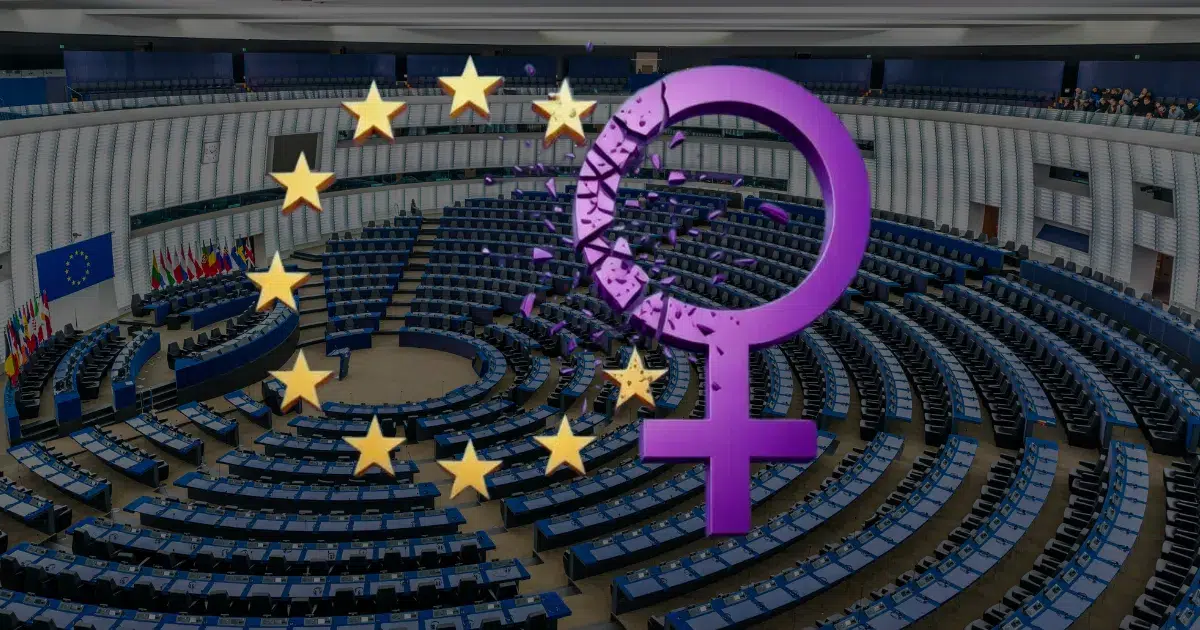Gewalt gegen Frauen ist für die Politik seit Jahren ein Randthema. Es gibt vermeintlich immer Wichtigeres zu tun, als Frauen vor Gewalt zu schützen. So erinnerten sich die Parteien erst auf den letzten Metern der Legislaturperiode 2021–2025 daran, dass Frauen mehr als die Hälfte der Bevölkerung und damit eine wichtige Wählergruppe stellen und verabschiedeten kurz vor knapp noch das sog. Gewalthilfegesetz.
Der Schutz von Frauen vor Gewalt darf jedoch kein Bonbon sein, das immer nur kurz vor Wahlen verteilt wird, sondern muss in der neuen Legislaturperiode Priorität haben. Denn die Zahl der Gewalttaten gegen Frauen steigt. Wir fordern daher von der Politik effektive Maßnahmen und hätten da einige Vorschläge und Forderungen.
Gewalt gegen Frauen in Deutschland – eine Bestandsaufnahme
Das Bundeskriminalamt hat in seinem Lagebild Häusliche Gewalt 2023 insgesamt 256.276 Opfer häuslicher Gewalt ausgemacht. Davon waren 70,5 % weiblich. 65,5 % der Opfer (167.865) waren von Partnerschaftsgewalt betroffen, 34,5 % von innerfamiliärer Gewalt. Damit zeigt sich, dass Frauen und Mädchen im sog. häuslichen Umfeld, zu dem unter anderem auch ehemalige Partnerschaften zählen, überproportional von Formen körperlicher, sexueller oder psychischer Gewalt betroffen sind.
Kontinuierlicher Anstieg von häuslicher Gewalt und Femiziden
Die Zahlen häuslicher Gewalt stiegen in den Jahren 2019 bis 2023 nahezu kontinuierlich an. 247 Frauen und Mädchen fielen ihr 2023 zum Opfer. Darunter sind 155 Frauen und Mädchen, die von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Insgesamt starben 360 Frauen und Mädchen 2023 in Deutschland durch Tötungsdelikte. Damit gab es fast jeden Tag einen Femizid (siehe Seite 37, Bundeslagebericht – geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichtete Straftaten).
Immer mehr Frauen Opfer von Sexualstraftaten
2023 wurden zudem jeden Tag mehr als 140 Mädchen und Frauen Opfer einer Sexualstraftat – 52.330 insgesamt. Erschreckend dabei: Mehr als die Hälfte von ihnen war unter 18 Jahre alt. Die Zahl der öffentlich gewordenen Sexualstraftaten stieg gegenüber dem Vorjahr übrigens um fast 6,2 Prozent an. Und das ist nur das Hellfeld. Viele Frauen und Mädchen zeigen derartige Straftaten nicht an.
Der kontinuierliche Anstieg von Gewalt gegen Frauen sollte die Politik hellhörig machen. Was also tut sie, um Frauen vor Gewalt zu schützen bzw. Gewalt gegen Frauen vorzubeugen?
Welche Regelungen gibt es, die Frauen helfen und schützen sollen?
Der Deutsche Bundestag hat am 31. Januar 2025 das sogenannte Gewalthilfegesetz verabschiedet. Der Bundesrat hat ihm am 14. Februar 2025 zugestimmt. Das Gesetz, das eigentlich Gesetz für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt heißt, soll Frauen und Kindern helfen, die bereits von Gewalt betroffen sind. Das Gewalthilfegesetz gewährt ihnen einen kostenfreien Rechtsanspruch auf Schutz (d. h. etwa einen Platz im Frauenhaus) und Beratung. Damit werden Frauen an den Kosten für die Unterkunft im Frauenhaus nicht länger beteiligt, was für viele gewaltbetroffene Frauen in einer ohnehin schwierigen Situation bislang eine weitere Herausforderung darstellte.
Das Problem: Dieser Rechtsanspruch tritt erst am 1. Januar 2032 in Kraft, um den Bundesländern ausreichend Zeit zu geben, das Gesetz umzusetzen – also zum Beispiel die Zahl der Frauenhausplätze zu erhöhen. Frauen müssen also weitere sieben Jahre warten, bevor sie auf ihr Recht pochen können.
Gewaltschutzgesetz
Außerdem gibt es das Gewaltschutzgesetz (Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen). Durch dieses Gesetz kann unter anderem gerichtlich angeordnet werden, dass eine gewalttätige Person
- sich der Wohnung des Opfers nur bis zu einem festgesetzten Umkreis nähern darf,
- sich nicht dort aufhalten darf, wo sich das Opfer regelmäßig aufhält (zum Beispiel in der Nähe des Arbeitsplatzes des Opfers oder nahe der Schule der Kinder),
- keinen Kontakt zum Opfer aufnehmen darf – auch nicht über Mails oder Telefon.
Außerdem können Gewalttäter der gemeinsamen Wohnung verwiesen werden – zunächst von der Polizei für einige Tage, gerichtlich angeordnet auch auf längere Zeit.
Keine Gewaltprävention, sondern Hilfe nach Gewalt
Diese Gesetze setzen jedoch erst in den Fällen an, in denen bereits Gewalt (und zwar in der Regel körperliche Gewalt) angewendet wurde, also das Kind – sprichwörtlich gesehen – bereits in den Brunnen gefallen ist. Sie sind für Gewaltopfer wichtig, doch zur Gewaltprävention tragen sie nicht bei.
Auch können manche Regelungen (zum Beispiel das Verbot der Annäherung aus dem Gewaltschutzgesetz) nicht effektiv umgesetzt werden, wenn nicht zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, um die von Gewalt Betroffenen zu schützen. Hierzu würde zum Beispiel die Möglichkeit gehören, Tätern elektronische Fußfesseln anzulegen, die per elektronischer Aufenthaltsüberwachung prüfen, dass sie sich ihren Opfern nicht über den gerichtlich festgelegten Umkreis hinaus nähern. Kommen Täter ihren Opfern zu nahe, gibt es einen Alarm, sodass die Polizei einschreiten kann. In Sachsen wurde dieses Modell Anfang Januar 2025 bereits erstmals angewendet, Hessen zog Ende Januar 2025 in einem ersten Fall nach.
Es war zwar vorgesehen, das bundesweit geltende Gewaltschutzgesetz um eine Fußfesselregelung zu erweitern. Doch die Pläne wurden Anfang 2025 auf Eis gelegt. Kritik an den vorgesehenen Änderungen brachte zum Beispiel der hessische Justizminister Christian Heinz (CDU) vor. Er bemängelte unter anderem, dass bei Verstößen gegen das Tragen der Fußfessel nur Ordnungsgelder verhängt werden sollten, statt zu ermöglichen, dass der Täter die Fessel auch gegen seinen Willen trage. Auch befürchtete er, dass die Kosten für die Fußfessel die Opfer zu tragen hätten, gäbe es keine ergänzende Regelung im Gesetz, die dies verhindere.
Gewaltprävention – ein Forderungskatalog
Gewalt im häuslichen Umfeld, zu dem auch Ex-Partner zählen, entwickelt sich oft schleichend. Sie beginnt in der Regel mit psychischer Gewalt und Kontrolle. Oft kommt es erst später zu Einschüchterungen (zum Beispiel durch die Zerstörung von Gegenständen oder der Androhung von körperlicher Gewalt) und schließlich zu körperlicher Gewalt. Die britische Kriminologin Prof. Jane Monckton-Smith hat ein 8-Stufen-Modell entwickelt, mit dem sich Gewalt in Beziehungen und die Gefahr für Tötungen in diesem Zusammenhang vorhersagen lassen. Stufe 3 in ihrem Modell umfasst die sogenannte Coercive Control, die regelmäßig ein Indikator für spätere schwere körperliche Gewalt ist.
Coercive Control als Straftatbestand einführen
Was ist Coercive Control?
Coercive Control heißt auf Deutsch so viel wie Zwangskontrolle, Die folgende Definition stammt aus Großbritannien, wo Coercive Control seit Ende 2015 strafbar ist:
„Coercive Control zeichnet sich durch kontrollierendes Verhalten aus. Darunter ist eine Reihe von Handlungen zu verstehen, die darauf abzielen, eine Person unterzuordnen und/oder abhängig zu machen, indem sie sie von unterstützenden Menschen isolieren, ihre Ressourcen und Fähigkeiten zur persönlichen Bereicherung ausnutzen, sie der Mittel berauben, die sie für ihre Unabhängigkeit, ihren Widerstand und ihre Flucht benötigen, und ihr Alltagsverhalten regulieren.
Zugleich definiert sich Coercive Control durch ein Zwang ausübendes Verhalten: Darunter ist eine fortgesetzte Handlung oder ein Muster von Handlungen wie Übergriffe, Drohungen, Demütigungen und Einschüchterungen oder andere Misshandlungen zu verstehen, die dazu dienen, dem Opfer zu schaden, es zu bestrafen oder ihm Angst zu machen“.
Außerdem muss die Kontrolle/der Zwang „wiederholt oder kontinuierlich“ stattfinden; das Verhaltensmuster muss eine „schwerwiegende Auswirkung“ auf das Opfer haben; und das Verhalten des Täters muss so beschaffen sein, dass er wusste oder „hätte wissen müssen“, dass es eine schwerwiegende Auswirkung auf das Opfer haben würde.
Es geht also nicht um ein einmaliges Verhalten, sondern um ein Verhaltensmuster: Die Täter mikromanagen das Leben der Opfer, indem sie ihnen alles Mögliche vorschreiben (z. B. die Kleidung, die sie tragen dürfen). Sie halten sie mit Worten klein („Du kannst nichts, du machst alles falsch“), verzerren ihre Wahrnehmung durch Manipulationstechniken wie Gaslighting, nehmen ihnen die Fähigkeit zu eigenen Entscheidungen, isolieren ihre Opfer von Menschen, die sie unterstützen könnten, und setzen oft Maßnahmen der Überwachung ein (zum Beispiel kontinuierliches Texten oder Kontrollanrufe, wenn die Opfer nicht in Begleitung der Täter sind).
Einzelnormen bilden Coercive Control im deutschen Strafrecht nicht ab
Das Verhaltensmuster „Coercive Control“ wird derzeit durch das deutsche Strafrecht nur unzureichend abgebildet. Es gibt zwar die Straftatbestände der Beleidigung, der Nötigung, des Stalkings, der Bedrohung und der Körperverletzung, doch handelt es sich dabei um Einzelnormen, die diesem Verhaltensmuster in seiner Komplexität nicht gerecht werden.
Psychische Gewalt kann besser geahndet werden
Zur Vorbeugung von körperlicher Gewalt, die auf Coercive Control gemäß dem 8-Stufen-Modell von Prof. Jane Monckton-Smith regelmäßig folgt, muss auch Deutschland einen Straftatbestand „Coercive Control“ analog dem in Großbritannien einführen. Damit könnte endlich psychische Gewalt in Beziehungen leichter geahndet werden, die schwere seelische, aber auch körperliche Folgen (Krankheiten, Gewichtsab- oder -zunahme) hat.
Ein Straftatbestand „Coercive Control“ würde damit auch dazu beitragen, endlich weitere Punkte der Istanbul-Konvention umzusetzen. Denn die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die Deutschland bereits 2018 ratifiziert hat, sieht nicht nur den Schutz vor körperlicher, sondern auch vor psychischer und wirtschaftlicher Gewalt vor.
Mit der Einführung eines solchen Straftatbestands würden nicht zuletzt die Verhaltensmuster, die bei Coercive Control und psychischer Gewalt stets eine Rolle spielen, stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken. Auch hierdurch ließe sich häusliche Gewalt in gewissem Maße vorbeugen. Denn wer die Mechanismen von Coercive Control kennt und erkennt, kann sich selbst besser schützen.
Bessere Ausbildung der Entscheider
Die Feministin Katrin Kemmler hat auf X einen weiteren Forderungskatalog zur Gewaltprävention und zum Gewaltschutz aufgestellt, an dem wir uns unter anderem orientieren. So sollten alle Entscheidungsträger bei häuslicher Gewalt/Coercive Control (Justiz, Ermittler, Gutachter, Familienhilfe, Jugendamt, Berater) nach dem 8-Stufen-Modell von Prof. Jane Monckton-Smith fortgebildet werden. Denn bislang werden die Muster, die zu Femiziden im häuslichen Bereich führen, nur unzulänglich erkannt.
Strafmaß ausschöpfen, Opfern helfen
Gewalt gegen Frauen, darunter vor allem auch Sexualstraftaten, wird in Deutschland bislang leider oft sehr milde bestraft. Es wäre – auch im Sinne der Abschreckung und damit der Gewaltprävention – sinnvoll, das Strafmaß stärker auszuschöpfen.
Fußfessel bei häuslicher Gewalt
Es muss bundesweit die Möglichkeit eingeführt werden, Tätern auch gegen ihren Willen eine Fußfessel anzulegen, um die Opfer zu schützen – für einen Zeitraum von wenigstens sechs Monaten. Die Kosten müssen entweder vom Täter oder von staatlicher Seite getragen werden.
Täterprogramme überprüfen
Eine wesentliche Rolle in der Prävention von Gewalt gegen Frauen spielen derzeit Täterprogramme. Die Frage stellt sich, ob diese Programme die gewünschten Ergebnisse erzielen. Eine Evaluation mithilfe von Studien nach internationalen Standards wäre daher unabdingbar. Diese Evaluation müsste zudem alle Betreuungs-Programme für entlassene Sexualstraftäter umfassen. Die Kosten und Resultate der Programme müssen veröffentlicht werden.
Bei der Ermittlung von Frauenmorden einem strengen Protokoll folgen
Jeder Femizid muss genauestens untersucht und veröffentlicht werden. Auch dann, wenn der Täter nicht mehr lebt. Eine regional und personell unabhängige Einheit muss eingerichtet werden, die mögliches Versagen durch die Polizei und/oder Staatsanwaltschaft und weitere Behörden untersucht und öffentlich Bericht erstattet.
Die Aussagen von Frauen ernst nehmen
Noch immer stoßen Frauen bei Behörden auf Granit, wenn sie sich aus Angst vor dem Verhalten ihres Partners oder eines anderen Täters an sie wenden. Ihre Aussagen werden zum Teil abgetan, nicht zuletzt, weil Täter, die aus dem häuslichen Umfeld stammen, oft ruhiger und gefasster agieren als die betroffenen Frauen. Hier müssen die Behörden stärker in die Verantwortung genommen werden, Frauen und ihre Ängste ernster zu nehmen. Die Familienhilfe und das Jugendamt sollten zum Täter- und Opferverhalten fortgebildet werden, vor allem auch diejenigen, die für Prüfungen auf Kindeswohlgefährdungen zuständig sind.
Gutachter in Familienrechtsangelegenheiten und bei Frauenmorden müssen besser ausgebildet sein
Grundvoraussetzung für alle psychologischen Gutachter in der Justiz muss sein, dass sie sich das Wissen um den internationalen Forschungsstand aneignen. Englisch darf für sie keine Fremdsprache sein, viele Erkenntnisse stammen aus dem englischsprachigen Raum. Auch müssen sie zu Coercive Control fortgebildet werden.
Öffentlichkeit für den überwiegenden Großteil der Prozesse um häusliche und sexuelle Gewalt
Die Öffentlichkeit sollte bei derartigen Prozessen nur ausgeschlossen werden, wenn es das Opfer ausdrücklich wünscht. Wie Gisèle Pelicot im Vergewaltigungsprozess gegen ihren Ex-Mann und zahlreiche Männer sagte: Die Scham muss die Seite wechseln!
Kostenloser Zugang zu Haaranalysen – Stichwort: chemische Unterwerfung
Viele sexuelle Übergriffe finden mittlerweile statt, nachdem Frauen unter Drogen gesetzt wurden (in Frankreich spricht man von der sog. chemischen Unterwerfung). Die Krankenkassen sollten beim Verdacht darauf Haaranalysen finanzieren.
Zudem müssen alle angezeigten Fälle von chemischer Unterwerfung erfasst und veröffentlicht werden.
Daneben muss geregelt werden, dass Medikamenten, die am häufigsten eingesetzt werden, um Frauen sexuell gefügig zu machen, Farb- und/oder Bitterstoffe beigemischt werden. So ließe sich die Gefahr rasch erkennen.
Strengere Zugangskontrolle zu Pornografie für Minderjährige
Pornografie vermittelt ein Bild von Frauen als Objekte. Werden sie als Objekt gesehen, sinkt die Hemmschwelle, ihnen gegenüber gewalttätig zu werden. Aus diesem Grund muss die Zugangskontrolle zu Pornografie strikt gehandhabt werden, sodass Minderjährige schwerer Zugriff bekommen.
Archaisches Weltbild von Frauen inakzeptabel
Nach dem Grundgesetz Artikel 3 sind Männer und Frauen in Deutschland gleichberechtigt. Menschen, in deren Weltbild Frauen Männern untergeordnet sind, müssen Grenzen gesetzt werden, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Es wird nicht immer möglich sein, ein festgefahrenes Weltbild zu ändern, doch bestimmte Verhaltensweisen sind – auch von juristischer Seite, zum Beispiel bei der Einbürgerung – nicht zu akzeptieren.